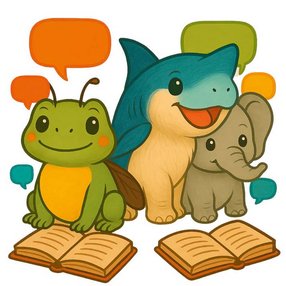Zu diesem Thema empfehlen wir den Blogbeitrag "Gut mischen! Translanguaging und schulische Realität" in unserer Rubrik "Im Fokus".
In unserer globalisierten Welt werden spezifische Kompetenzen benötigt, um effektiv, konfliktfrei und über Sprachgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Gemäß dem Translanguaging-Konzept werden Sprachen in unserem Gehirn nicht getrennt voneinander gespeichert. Vielmehr sind sie miteinander netzwerkartig verbunden. Konkret heißt das: Je nach Kommunikationssituation werden Sprachen gemischt, zwischen Sprachen wird gewechselt oder mehrere Sprachen werden gleichzeitig verwendet.
Was bedeutet Translanguaging?
Mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung ist zweisprachig oder mehrsprachig. Zählt man den regelmäßigen und systematischen Wechsel zwischen Sprachvarietäten – zum Beispiel zwischen Dialekt und Standardsprache – dazu, dann ist fast jede Sprecherin und jeder Sprecher im deutschsprachigen Raum mehrsprachig. Früher wurde oft behauptet, die Grenze zwischen Sprachen und Sprachvarietäten sei klar: Daheim redet man Dialekt, bei der Arbeit eine auch für internationale Kolleg:innen verständlichere Standardsprache oder Englisch.

Dieser Wechsel zwischen Sprachen und Varietäten wurde lange Zeit als Codeswitching bezeichnet. Die Sprachpraxis mehrsprachiger Menschen in sprachlich heterogenen Gesellschaften sieht jedoch in der Regel anders aus. So schleichen sich beispielsweise englische Wörter in deutsche Sätze ein, manche Begriffe werden in einem überwiegend deutschen Kontext auf Spanisch verwendet oder ein Satz wird auf Deutsch begonnen und auf Türkisch beendet. Dieses als Translanguaging bezeichnete Phänomen orientiert sich an Kommunikationspraxen mehrsprachiger Personen und sensibilisiert für den Gebrauch von Sprachen in verschiedenen Kontexten.
Translanguaging-Pädagogik
Bei der Translanguaging-Pädagogik werden alle von den Schülerinnen und Schülern mitgebrachten Sprachen als wertvolle Ressourcen für den Unterricht angesehen. Dieses Konzept steht auf den ersten Blick im Gegensatz zur monolingualen schulischen Norm, die die perfekte Beherrschung der Bildungssprache zum Ziel hat. Es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass die Nutzung des gesamten sprachlichen Repertoires der Schülerinnen und Schüler sie nicht nur auf die erfolgreiche Bewältigung mehrsprachiger Kommunikationssituationen vorbereitet und ein Bewusstsein für Diversität entwickelt, sondern auch den Erwerb der Bildungssprache fördert.

Eine Translanguaging-Pädagogik umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten:
- Sprachvergleiche
- Einbezug mehrsprachiger Materialien
- Nutzung verschiedener Arbeitssprachen
- Auseinandersetzung mit Themen wie Sprachverwendungen, Sprachgeboten, Sprachverboten, dem Zusammenhang von Sprachen und Macht u.ä.
Mediationspraktiken sind ein weiterer wichtiger Baustein der Translanguaging-Pädagogik. Sie fokussieren auf die Vermittlung zwischen Sprachen und/oder Personen, z.B um Inhalte verständlich zu machen).
Beispielsweise kann in der Zielsprache gelesen/gehört werden, während (schriftliche) Antworten, Notizen oder Diskussionen zum Text in den Erstsprachen erfolgen. Anschließend wird das Gesagte/Geschriebene in der Zielsprache zusammengefasst.
FAQs von Lehrpersonen zum Thema "Translanguaging"
Lehrende mit wenig Erfahrung in Translanguaging-Pädagogik sind oft unsicher, ob dieser Ansatz für sie geeignet ist. In diesem Video beantworten wir die fünf häufigsten Fragen. Das Transkript des Videos zum praktischen und schnellen Ausdrucken steht ebenfalls als Download bereit.
Wie unterstützt das ÖSZ Lehrpersonen bei der Umsetzung von Mediations- und Translanguagingaktivitäten im Unterricht?
- ÖSZ-Moodle-Plattform, die mit neuen Materialien laufend erweitert wird
- Kurze Videos zur Erklärung der zentralen Themen
- Unterrichtssequenzen zur praktischen Umsetzung von Mediationsaktivitäten für Englisch und für die romanischen Sprachen